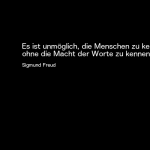Der letzte Kampf ist gekämpft. Aber nicht verloren.
Ein Mädchen ist gestorben. Nicht in der Zeitung oder den Nachrichten, sondern in meinem Bekanntenkreis. Sie starb mit 19 Jahren an Krebs. Vor den Augen ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihrer Freunde und ihrer Sportmannschaft.
Keine Therapie, keine Behandlung, kein Medikament konnten helfen. Sie verbrachte die letzten Tage ihres Teenager-Lebens im Krankenhaus, wo sie mit Schmerz- und Beruhigungsmitteln behandelt wurde. Aber wie schmerzfrei und ruhig konnte sie wohl sein, in einem Krankenhausbett. Ihrem Totenbett. Wie ruhig konnte sie sein, in dem Wissen, nur noch wenige Stunden zu Leben. Wie ruhig konnte sie sein, wenn sie ihrer Schwester und ihrer Mutter in die Augen sah, die innerlich auseinanderbrechen mussten vor Schmerzen. Und wie soll all das eine 19-jährige Seele überhaupt aushalten?
Das Mädchen ist jetzt tot. Diese Wörter gehen nicht leicht von der Hand oder über die Lippen – „tot“ und „sterben“. Deshalb verwenden wir sie auch kaum, wenn es um Menschen geht, die wir kennen oder gar lieben. In der Information über die Trauerfeier des Mädchens stand, sie habe „den Kampf gegen ihre schwere Krankheit verloren“. Und das stimmt natürlich. Trotzdem finde ich es schrecklich, das Wort „verlieren“. Sie hat doch nicht verloren. Das war keine Niederlage. Das war ja auch kein Wettkampf. Oder? Ich weiß schon, darum geht es nicht. Überhaupt nicht sogar. Wenn überhaupt, dann geht es darum, den Menschen, die dem Mädchen nahe standen, Trost und Beistand zu geben. Ich kannte das Mädchen selbst gar nicht. Und sogar ich war traurig. Sicher nicht, weil ich sie so vermissen werde, natürlich nicht, ich kannte sie nicht. Aber bestimmt deshalb, weil es uns vor Augen hält, dass solche schlimmen Dinge auch in der Wirklichkeit passieren, nicht nur im Fernsehen. Aber auch darum geht es jetzt nicht.
Das Unaussprechliche sagen
Ich habe darüber nachgedacht, wie wir eigentlich über ihn sprechen, den Tod. Es gibt sogar sehr viele Ausdrücke dafür, dass ein Mensch gestorben ist, ohne die Wörter „sterben“ und „Tod“ verwenden zu müssen. Metaphern und Euphemismen, die etwas so Schreckliches in ein halbwegs erträgliches Gewand hüllen sollen.
„In das ewige Leben eingehen“ verspricht, dass das, was der Tod bringt, doch eigentlich noch viel größer und schöner ist, als das irdische, begrenzte Leben. Es verspricht, dass nach dem Tod ein weiteres Leben auf uns wartet, das niemals enden wird, das nicht an das physische Leben gebunden ist. Diese Vorstellung ist interessanterweise Bestandteil fast aller Religionen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn diesen Wunsch müssen Menschen doch immer schon gehabt haben – das einzige, was uns wirklich klein und irrelevant auf dieser Welt macht, das Vergänglichsein, zu relativieren.
„Die letzte Ruhe finden“ klingt da schon viel endgültiger. Und doch erscheint der Tod etwas weniger beängstigend, wenn es einfach darum geht, „Ruhe“ zu haben, ruhig zu werden, Ruhe zu finden.
Wenn jemandens „Lebenslicht erlischt“, zeichnet dies ein klares Bild. In vielen Überlieferungen wird das Leben nämlich mit einem Kerzenlicht verglichen. Wenn ein Licht erlischt, so die überlieferte Vorstellung, erlischt auch ein Leben.
Jemand kann auch „in Abrahams Schoß eingehen“. Ein eigentlich schönes, wenn auch wenig gebräuchliches Bild aus dem Lukas-Evangelium, dem zufolge der arme Lazarus nach seinem Tod von Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde, wo er – geborgen und glücklich – keine Not mehr leiden musste. Auch das verspricht doch irgendwie ein glückliches Ende, bzw. kein Ende, sondern einen Neubeginn.
„In die ewigen Jagdgründe einzugehen“ klingt wieder viel weniger geborgen. Es ist auch keine Redewendung, die ich persönlich verwenden würde. Sie lässt auch auch kein besonderes Mitgefühl oder Sensibilität für den Verlust eines Menschen mitschwingen. Aber ihre Herkunft ist umso interessanter. Der Ausdruck bezieht sich anscheinend auf die mythologische Vorstellung der noradmerikanischen Indianer von einem als „Happy Hunting Ground“ bezeichneten Jenseits. Zumindest meint das der Duden.
Der Ausdruck „das Zeitliche segnen“ kommt im ersten Moment sehr grob daher, hat aber eine gar nicht so grobe Geschichte. Nach einem alten Brauch segneten Sterbende auf dem Totenbett alles „Irdische“, damals „Zeitliche“ genannt.
Und es gibt noch weitere sprachliche Bilder, die alle ausdrücken, was man eigentlich nie zu sagen haben will. Dass jemand plötzlich nicht mehr da ist und nie wieder zurückkommt, nicht mehr atmet, nicht mehr lebt. Bestimmt kann keiner dieser Ausdrücke einen trauernden Menschen trösten. Aber vielleicht kann so manche Vorstellung ein bisschen Hoffnung geben.